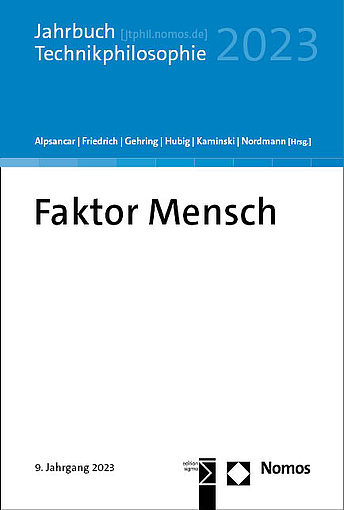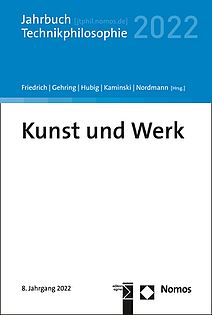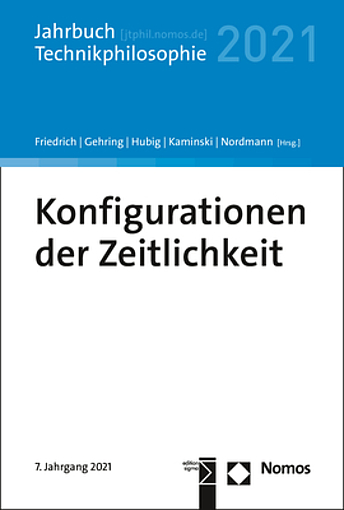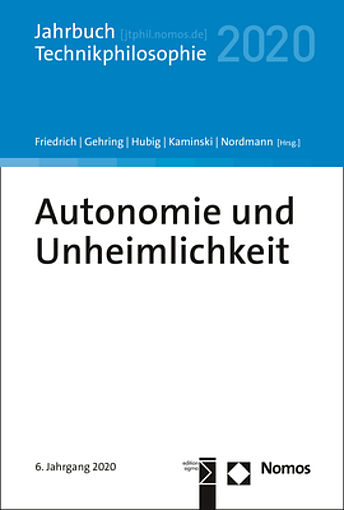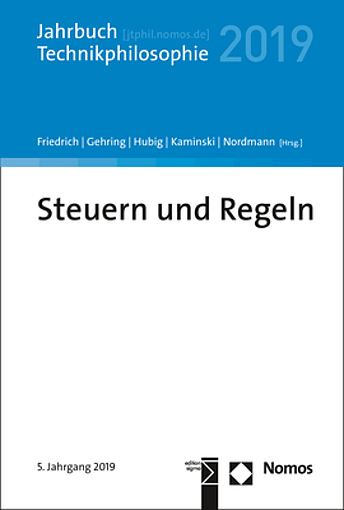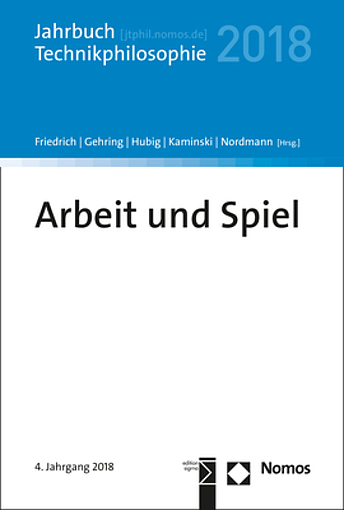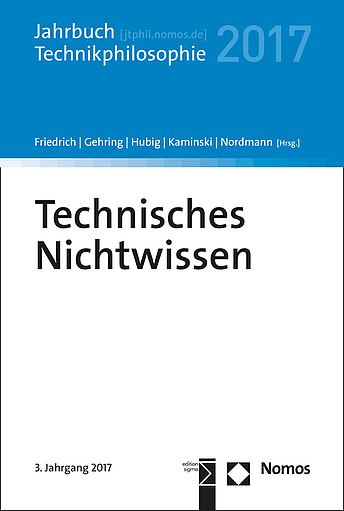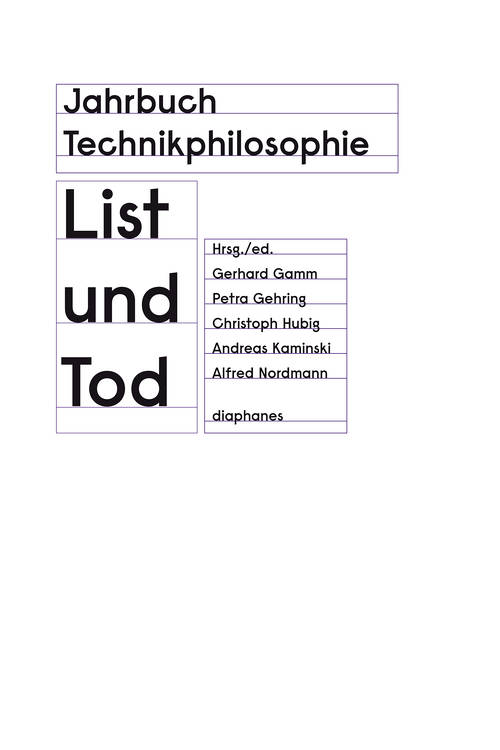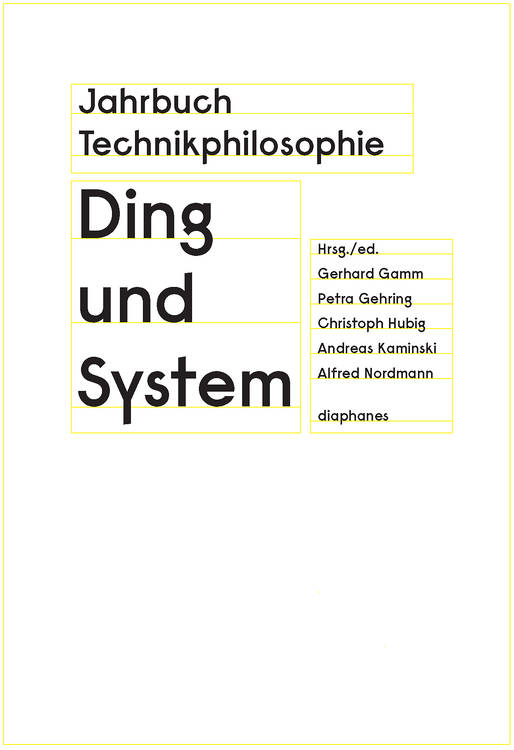2024
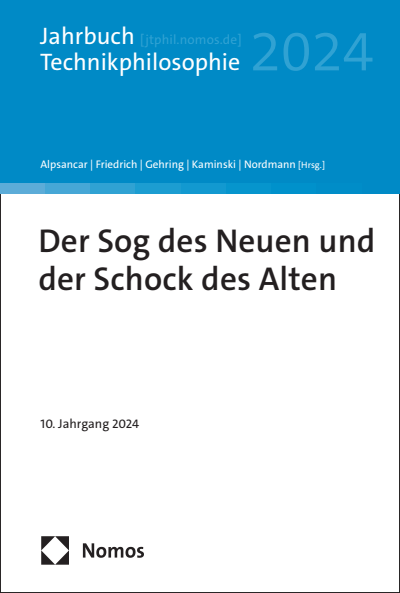
Der Sog des Neuen und der Schock des Alten
// Schwerpunkt: Nguyen Duc »Die Sprache des Neuen. Über Blitze, Blitzableiter und Geistesblitze« / Nickel »A Pluralistic Model of Technology-Driven Value Change« / Lee »From Mundane ›Nuclear‹ Solutions to Novelty. Instrumental Rationality in Making Technoscientific Cultures« / Schmidt »Künstliche Intelligenz und komplexe Forschungsobjekte. Wissenschafts- und technikphilosophische Reflexionen über KI-Unterstützung« / Richter » Hans Jonas’ Argumentation in Das Prinzip Verantwortung in methodologischer Betrachtung. Neue Perspektiven oder alte Hürden für die Angewandte Ethik?« // Abhandlung: Steinbach »Systematische Aspekte einer Geistesgeschichte der Technik« // Archiv: Heinrich Hardensett »Auszug aus Philosophie der Technik. Ihr Leben in der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts. Unveröffentlichtes Manuskript, ausgewählt und eingeleitet von Stefanie Theuerkauf« // Diskussion: Brenneis, Nguyen Duc, Wiengarn »Unraveling the Call of the Future« // Kontroverse: »Was ist das Falsche an der falschen Bewegung?« / Kleymann »Das Ereignis der Theorie unter den Bedingungen der Digital Humanities« / Matzner »Mehr als quantitativer Formalismus? Über die literaturtheoretischen Quellen der falschen Bewegung« / Gramelsberger »Epistemische Spuren freilegen« / Wilke »Von der ›falschen Bewegung‹ zur neuen Praxeologie« // Bericht: Eckes, Gehring »Innovation in der Praxis, oder: Wie entwickelt ein interdisziplinäres Forschungsprojekt einen digitalen Intermediär? Risiken und Gelingensbedingungen komplexer Kooperationsvorhaben« // Glosse: »Die Postapokalypse als zeitgenössisches Idyll«.
2023
Faktor Mensch
// Schwerpunkt: Schöberlein »Medien der Begeisterung: Das Gehirn als technik- und literaturhistorisches Phänomen« / Liggieri »Der ›Faktor Mensch‹ als Konzept einer technischen Moderne. Begriffsgeschichte und Analyse« / Heßler »›Faulty constructions‹. Die lebensweltliche Figur fehlerhafter Menschen« / Karl »Über die epistemische Macht lernender Maschinen« / Landkammer »Die Lücke, die die Maschine lässt. Über verzichtbare Assistenztechnologien« // Abhandlung: Anicker »Gestaltwandel der Technik? Techniksoziologische Reflexionen zu künstlicher Intelligenz« // Archiv: Sartre »Produkt und Produzent – Menschliche Existenz im vergesellschafteten Handlungsfeld der Technik. Eine Textcollage aus Das Sein und das Nichts und Kritik der dialektischen Vernunft mit einem einleitenden Kommentar von Marcel Siegler« // Diskussion: Krtilova »Wie sich Heideggers Werk als eine Medienphilosophie lesen lässt« / Gelfert »Wie die Mathematik ihre erstaunliche Formkraft gewinnt« / Kaminski »›How to do Philosophy of Technology‹« // Kontroverse: Wissenschaftler:innen-Tracking: Warnke »Wie Open Access Scholarly SPAM erzeugt« / Sprenger »Epistemische Asymmetrie« / Schembera »Die im Dunklen sieht man doch. Dunkle Daten und Datentracking in der Wissenschaft« / Mößner »Noch nicht ist schon zu viel. Datentracking und der Evaluierungswahn wissenschaftlicher Leistung« / Nosthoff, Maschewski »Wissenschaftler:innen als Influencer: Post it or Perish« / Reda »Mündiges Datensubjekt statt Laborratte: Rechtsschutz gegen Wissenschaftstracking« // Kommentar: Gehring »Wie die DFG digitale Transformationsprozesse fördern will. Informatik als universaler Enabler oder doch besser fachlich vielfältige digitale Kompetenzen?« // Glosse: »Lob der Abschaltbarkeit«.
2022
Kunst und Werk
// Schwerpunkt: Gehring »Wie treffen sich ›Technik‹ und ›Kunst‹? Zum konzeptionellen Zugriff« / Feige »Das ›Andere‹ der Technik, ein ›anderes‹ Technisches. Anmerkungen zum Verhältnis von Kunst und Technik« / Beinsteiner »Jenseits von affordance und Transzendentalismus: Zur Vermittlung zwischen Artefakten und Praktiken nach Heidegger« / Dombois »Encore: Körper und Code« / Siebert »Werksbesichtigungen. Inszenierungen von oeuvre und usine bei Caspar Schott, Andrea Keiz und Stefan Kaegi/Rimini Protokoll« / Nguyen Duc »Das Computerspiel als Entwurf – Eine produktionsästhetische Perspektive aufs Phänomen« / Kasprowicz »Ästhetik als Unschärfe – Günther Anders und die Frage nach dem Film als Kunst« / Wittingslow »Philosophy of Technology and Aesthetic Cognitivism« / Reineke, Wolter »Kunst und Standards. DIN-Normen und RAL-Farben in Carsten Beckers Werkserie DIN« // Abhandlung: Becker »Göttliche Protokolle, Bitcoin-Jünger und schattenhafte Herrscher: Über die religiösen Anwandlungen und ideologischen Verstrickungen der Blockchain-Technologie« / Ullmann »Das Sobjekt: Mögliche Beziehungen zwischen Mensch und Maschine aus einem phänomenologischen Blickwinkel« // Archiv: »Historische Perspektiven von Blumenbergs Technikphilosophie« // Diskussion: Formanek »Ist der Transhumanismus ein technokratischer Totalitarismus?« / Becker »Technische Postmoderne: Vom thought lag zu virtue realities« // Kontroverse: Oehler, Wiesemann »Eizellspenden, Leihmutterschaft, Embryonenforschung: Wie weit darf und soll Reproduktionsmedizin ihre Möglichkeiten ausreizen und weiterentwickeln?« // Kommentar: Hallensleben, Hauschke »Zur Rolle von Reliability im Rahmen der Operationalisierung von KI-Ethik« // Glosse: Rustemeyer »Wert und Werk. Über Damien Hirst: The Currency«.
2021
Konfigurationen der Zeitlichkeit (Gastherausgeber: Thomas Hilgers, Ludger Schwarte)
// Schwerpunkt: Hilgers »Technik und Zeit bei Heidegger« / Förster »Zwischen Mensch und Maschine. Zeitstrukturen in technologischen Lebenswelten« / Lederle »Der Zusammenhang von Technisierung, Zeitgewinn und Selbsterhaltung im Ausgang von Hans Blumenberg« / Müller »Social Media und das Leiden an der Herrschaft der Timeline« / Schwarte »Zeit, Architektur und Kontrolle« / Hörl »Environmentalitäre Zeit« / Gramelsberger, Friedrich, Waltenspül »Wissenschaftslabore als artifizielle Zeitkonfigurationsräume. Techniken der Dehnung, Transformation und Aufhebung von Zeit« // Abhandlung: Del Fabbro »In Between the Natural and the Artificial: The Mode of Existence of Self-Reproducing Cellular Automata« / Weiß »Rules of the Game. Über den formenden Einfluss eines technischen Regelbegriffs« / Borck »Why Not Postphenomenology? Ein Zwischenruf zu Don Ihdes Technikphilosophie« // Archiv: Merleau-Ponty »›Die Gewohnheit‹ – Wahrnehmungsphänomenologie als Weg in die Technikphilosophie?« // Diskussion: Hommrich »Technogene Menschenkunde?« / Poljanšek »Ein gewogener Leser auf Tauchstation« / Meutgens »Mit Todesalgorithmen mal eben die Welt retten« // Kontroverse: Liu, Mitcham, Nordmann »Corona Perspectives – Philosophical Lessons from a Pandemic« / Folkers »Bevölkerung und vitale Systeme, oder: Die Kurve und die Linie« / Böschen »Spannungsfelder von Kontrolle und Erproben: Konturen einer ›verfeinerten Technokratie‹?« / Mende »Public and Individual Interests – Implications of the COVID-19 Pandemic« / Fuller »Prolegomena to the Political Science of Civil Libertarianism« / Coenen »Breaking the Spell of TINA – An Integrative Notion of Socio-Technical Progress« / Winner »The Virus Is a Catalyst, Society Itself the Disease« / Schomberg »Global Public Goods« / Umlauf »Zur technischen Krisenhaftigkeit der Corona Krise« / Schwarz »Corona und Körperumwelten – Ökotechnologische Erkundungen« // Kommentar: Hagendorff »Ethics of Machine Learning. A Critical Appraisal of the State of the Art« // Glosse: Nordmann »Verweigerung der Zeit – Mannheimer Stellungnahmen«.
2020
Autonomie und Unheimlichkeit
// Schwerpunkt: Adamowsky »Unheimliche Lebendigkeit« / Gransche »Technogene Unheimlichkeit« / Voller »Die unheimliche Verkehrung. Anmerkungen zu einem Topos der Moderne« / Cheng »Das Unheimliche der Entfremdung: Humanoide Roboter und ihre Buddha-Natur« / Trimble »Brains Situated, Active, and Strange: Neurosurgical magnification and physicalism’s aesthetic consequences« / Mainzer »Zwischen Autonomie und Unheimlichkeit: Blinde Flecken im Machine Learning« // Abhandlung: Richter »Sind Erfindungen ›neue Artefakte‹? Zur Explikation der Tätigkeit des Erfindens als praktische Synthese neuer Handlungsschemata« // Archiv: Pollock »Auszug aus Automation. Materialien zur Beurteilung ihrer ökonomischen und sozialen Folgen (1964). Mit einem Vorwort von Tom Poljanšek« // Diskussion: Loidolt »Techno-Phänomenologie. Von multistabilen Diskursen, Meisterdenkern und der Neugier auf Technologie« / Maschewski, Nosthoff »Technologie als Metapher« / Remmers »Weder neutral, noch verantwortlich – zum moralischen Status der Technik« / Nordmann »French Philosophy of Technology« / Friedrich »›All the bank-able species‹ – Zwischen Bewahren und Nutzen: Biobanken auf der Suche nach ihrem Paradigma« / Pedziwiatr »Wittgenstein – ein vergessener Technikphilosoph?« // Kontroverse: Ihde, Kaminski »What is postphenomenological philosophy of technology?« // Kommentar: Kaminski »Friendly to grotesque. Qualities of the Uncanny in the Art of Regina Silveira« / Winner »Autonomous Technology – Then and Still Now. An interview« // Glosse: Poljanšek »Die satte Leere schwarzer Schatten. Anmerkungen zu einer Unheimlichkeit zweiter Ordnung« / Lampe »Wer haucht der Puppe die Seele ein: Über Belebtes im Kinderzimmer« / Heßdörfer »Die Welt ist das, was der Ball ist: Über unheimliches Spielzeug« / Friedrich »Aufklärung für Ex-Zocker«.
2019
Steuern und Regeln
// Schwerpunkt: Liggieri »Der Regelkreis als das ›universelle Gebilde der Technik‹. Zugriffe auf Mensch und Maschine zwischen ›allgemeiner Regelungskunde‹ und philosophischer Anthropologie bei Hermann Schmidt« / Nosthoff, Maschewski »›We have to Coordinate the Flow‹ oder: Die Sozialphysik des Anstoßes. Zum Steuerungs- und Regelungsdenken neokybernetischer Politiken« / Sprenger »Ort und Bewegung – Mobile Adressierung, cellular triangulation und die Relativität der Kontrolle« / Wichum »Auf der Schwelle. Die soziologische Systemtheorie Niklas Luhmanns, die Kybernetik und der Computer um 1970« / Herrmann »Generieren wir eine Logik der Entdeckung durch Machine Learning?« / Tamborini »Umwelt und organische Form: Technowissenschaftlicher Zugang zur Historizität der Evolution« // Abhandlung: Blättler »Natürliche Technologie und technische Differenz. Kapp und die Frage der Biologie für den Kulturapparat, gelesen mit Kant und Blumenberg« // Archiv: Hardensett »Auszug aus Philosophie der Technik (2017). Erweiterte Edition, ausgewählt und eingeleitet von Christoph Hubig« // Diskussion: Hommrich »Ethik – als Strichliste. Spyros Tzafestas führt durch die ›Roboterethik‹ und gibt dabei einen Überblick, der mit Philosophie und Technikethik wenig zu tun hat« / Dickel »›Das verknöcherte humanistische Skelett…‹ verbessern, erweitern, zerbrechen, ersetzen. Eine Einführung in die Ismen der Selbstüberwindung des Menschen« / Brenneis »1LF3RUF: Ethik zwischen Front- und Back-End?!« // Kontroverse: »Brauchen wir eine Roboterethik? Eine Kontroverse mit Susanne Beck, Bruno Gransche, Eric Hilgendorf, Janina Loh, Catrin Misselhorn und Thomas Zoglauer« // Kommentar: Nerurkar, Wadephul, Wiegerling »Metaphorik in der Technikethik: Ein Kommentar anlässlich der Big Data-Stellungnahme des Deutschen Ethikrats« // Glosse: Denker »Mit Sicherheit genervt«.
2018
Arbeit und Spiel
// »Mehr als ein Technikphilosoph – Zum Tode von Günter Ropohl« // Schwerpunkt: Meißner »Arbeit und Spiel – mit Technik neu bestimmt« / Laas »Instrumental Play« / Heßdörfer »Das Spielgeld der Pädagogik. Freiheit, Zwang und Arbeit in der Pädagogisierung des Spiels um 1900« / Raczkowski »Play, Work and Ritual in Gamification« / Klager »Die Ethik des Als-ob. Video- und Computerspiele als technische Sphären der Ethik« / Saam, Schmidl »›A distinct element of play‹. Scientific computer simulation as playful investigating« / Amigoni, Schiaffonati »Robotic competitions as experiments: From play to work« / Voß »Arbeitende Roboter – Arbeitende Menschen. Über subjektivierte Maschinen und menschliche Subjekte« / Ette »Kosmos Herakles. Zu einer Erzählung Alexander Kluges« / Rautzenberg »Einübung ins Ungewisse« // Abhandlungen: Hubig »Der Deus ex Machina reflektiert. Ernst Kapps Technik-Anthropologie zwischen Thomas von Aquin, Hegel und Latour« / Schmidt »Die Selbstoptimierung des Selbst. Zur Technikphilosophie des Neuroenhancements« / Kaminski, Resch, Küster »Mathematische Opazität. Über Rechtfertigung und Reproduzierbarkeit in der Computersimulation« / Nordmann »Four Horsemen and a Rotten Apple. On the Technological Rationality of Nuclear Security« // Archiv: Kluge »Heiner Müller und ›Die Gestalt des Arbeiters‹« // Diskussion: Karafyllis »Homo faber revisited. Eine philosophische Bestandsaufnahme der ›Machbarkeit‹« / Lampe: »Modellieren: Ansätze für die Grundlegung zu einer interdisziplinären Praxis« / Lemmens »Transductive reticulation: How to reflect on digital thinghood« // Kontroverse: Technikhermeneutik: Ein kritischer Austausch zwischen Armin Grunwald und Christoph Hubig« // Kommentar: Gehring »Digitalissimo humanissimo! ›Die DH‹ zwischen Marke und Methodik« // Glosse: Brenneis »Unboxing«.
2017
Technisches Nichtwissen
// Schwerpunkt: Poljanšek »Die Vorstrukturierung des Möglichen – Latenz und Technisierung« / Carney »Knowing Ignorance: The Fragility of Technological Application« / Burkhardt »Vorüberlegungen zu einer Kritik der Algorithmen an der Grenze von Wissen und Nichtwissen« / Lenhard, Hasse »Fluch und Segen: die Rolle anpassbarer Parameter in Simulationsmodellen« / Vehlken »Super-GAU und Computersimulation. Technisches Nichtwissen in der zivilen Nuklearforschung« / Pravica »Variablen des Unberechenbaren. Eine Epistemologie der Unwägbarkeiten quantitativer Voraussageverfahren in Sicherheit und Militär« / Solhdju »Rätselhafte Zukunft. Medizinische Prädiktionen zwischen Wissen und Nichtwissen« / Kanitz »Naturwissenschaftliches und technisches Nichtwissen. Emil du Bois-Reymond trifft Ernst Kapp auf der Grenze der Erkenntnis« / Paulitz »Wissenskulturen und Machtverhältnisse. Nichtwissen als konstitutive Leerstelle in der Wissenspraxis und ihre Bedeutung für Technikkulturen« / Koch, Köhler »Wahnverwandtschaften 1900/1800. Friedrich Kittlers paranoische Medienhistoriografie« // Abhandlungen: Sprenger »Maschinen, die Maschinen hervorbringen. Georges Canguilhem und Friedrich Kittler über das Ende des Menschen« / Métraux, Frisch »Seelenabdruck oder was sonst? Zur Kritik des Hirnbildgebrauchs« / Zill »Von der Atommoral zum Zeitgewinn: Transformationen eines Lebensthemas. Hans Blumenbergs Projekt einer Geistesgeschichte der Technik« // Archiv: Sombart »Technik und Kultur. Mit einem Vorwort von Günter Ropohl« // Diskussion: Greite »Tugend der Entselbstverständlichung. Über Blumenbergs Phänomenologie der Technik« / Alpsancar »›Vom Dreigestirn über mir zur Technik in mir‹. Zur Neubestimmung unseres technischen Welt- und Selbstverhältnisses« / Bullmann »Vorsprung durch Technik. Bastler und Trickster als Gegenspieler der Systemtechnik« / Gamm »Perspektiven, Paradoxien und Parodien. Philosophisches Denken in einer technisch verödeten Welt« / Kaminski »Technik und Weltbezug. Wie wissenschaftliche Erfahrung möglich ist« // Kontroverse: »Design/Politics. A Critical Exchange in Two Rounds between Alfred Nordmann and Pelle Ehn« // Kommentar: Alpsancar »Von der Cultura zur Option: Wie Samenbanken als Sicherungstechniken Realwerte in Optionswerte verwandeln« // Glosse: Gehring «Über Kaputtheitsärger und Exorzismen des Defekts«.
2016
List und Tod
// Schwerpunkt: Schmitz-Emans »Der Tod und die Umwege. Über Erzähltechniken und Erzählerlisten in Labyrinthgeschichten« / Friedrich, A. »Die Vergänglichkeit überlisten. Leben und Tod in kryogenen Zeitregimen« / Blättler »Ewiger Prometheus, lange Schatten Gottes und die Listen der List. Über mythologische, eschatologische und formale Szenarien moderner Technik« / Friedrich, J. »Köder, Falle und die List des Tricksters« / Kaminski, Schembera, Resch, Küster »Simulation als List« / Denker »Spuren des Tötens. Die List im Drohnenkrieg« / Gaycken »Technik, List und Tod aktuell. Ein Kommentar zur militärischen Dimension der List« // Abhandlungen: Gramelsberger »Figurationen des Phänomenotechnischen« / Woelert »Why technology is more than an ›extension‹ of the body« / Zoglauer »Wie Robotik, Neuroprothetik und Cyborg-Technologien unser Verständnis von Handlung und Verantwortung verändern« // Archiv: Jullien »Über die Wirksamkeit (Auszug)« // Diskussion: Hui »Thinking philosophy from the perspective of technology. Two readings of Simondon« / Huber »Big Data, Big Promises, Big Science. Ein Statusbericht« / Brenneis »Technik zum Einstieg. Ausdifferenziertes mit Kornwachs« / Zubeldia »Une guerre virtuelle. Un emploi stratégique controversé« / Alpsancar »Reflexionen des Technischen zwischen Überleben und gutem Leben« // Kontroverse: Böhme »Zivilklauseln für eine Technische Universität?« / Leng »Position zur Zivilklausel« / Kriesel »Zivilklausel – Leuchtpfad für eine friedliche Gesellschaft?« // Kommentar: Karafyllis »›Technics‹ and ›Technology‹ in Arabic language contexts« // Glosse: Friedrich, A. »Doch nichts zu verbergen. Zur Antiquiertheit des Überwachungsskandals«.
2015
Ding und System
// Schwerpunkt: Luckner »Ding und Bestand. Heidegger und das Wesen neuzeitlicher Technik« / Bourg »Bruno Latour ou les errements des objets hybrides« / Bontems »Simondons Klassifizierung der technischen Objekte« / Houkes, Vermaas »Technical Artefacts and Agentive Roles. From Use Plans to Sociotechnical Systems« / Rheinberger »Experimentalsysteme und epistemische Dinge« / Nordmann »Werkwissen oder: How to express things in works« // Abhandlungen: Kogge »Die Frage nach den Kriterien. Wittgensteinsche Perspektiven für die Technikphilosophie« / Kaiser »Do You Speak Technology? On Grammars of Technology« / Bachem, Dragomir, Frei, Hackler, Misteli »›…isn’t technology the fucking bomb? Technik und Krieg in der TV-Serie The Wire« / Gerhardt »Die digitale Innovation. Die Technik erschließt das Bewusstsein« / Lenhard »Kann Technik die Naturgesetze verändern? Zu den technischen Erfolgsbedingungen fundamentaler Gesetze« // Archiv: Hottois »Technoscience et sagesse?« // Diskussion: Seibel »Robuster Realismus« / Berr »Spannung um den Entwurf« / Nagenborg »Smart oder Stereotyp?« / Becker »Synchronisierung ausleuchten« / Tibatong »Verwunderte Bemerkungen zur Philosophie der Artefakte« // Kontroverse: Ropohl »Christoph Hubig« // Kommentar: Denker »›Big Brother brutal zerhackt. Rückblick auf den ersten Hackerparagraphen 1986« // Glosse: Gehring »Das Unbehagen an der Netzkultur«.